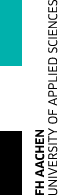Ein Plädoyer für eine entwurfsbezogene Bildwissenschaft
von Oliver Wrede
Dezember 2005
Beitrag in der Boxhorn 12 zum Thema »Sehsturz«
»Worüber man nicht reden kann, das muss man zeigen!« (frei nach Wittgenstein)
Die Frage nach der Sehstörung bekommt einen spezifischen Sinn wenn man Sehen durch Anschauung ersetzt. Mit »Sehsturz« wäre demnach nicht etwa der Verlust der Sehsinns gemeint, sondern die Beeinträchtigung der Erkenntnisfähigkeit. Nun ist Anschauung nicht gleichbedeutend mit Erkenntnis, aber tatsächlich verwenden wir in unserer Sprache »Sehen« und »Erkennen« oft synonymisch: wir »sehen etwas ein«, haben »Visionen«, machen uns »Bilder« von Sachen, sind »blind vor Liebe«, haben »auf den ersten Blick« einen Eindruck, usw.
Die geistige Versunkenheit – die Kontemplation – stammt vom lateinischen contemplatio (Betrachtung, Schauen, geistiges Anschauen des Übersinnlichen). Diese Eigenart, dass wir das Sehen als Metapher für geistige Prozesse und Zustände verwenden (können), deutet an, wie tief das Sehen mit unserem Denken verwickelt ist. Die Philosophie hat eine eigene Disziplin dafür formuliert: die Epistemologie (Erkenntnistheorie). Und nicht von ungefähr sind die wesentlichsten Fragen der Erkenntnistheorie zugleich auch Fragen nach der Wahrnehmung, der Kognition und wie durch Wahrnehmung und Kognition eine Anschauung entsteht.
»Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.« (Antoine de Saint-Exupéry)
Ein ernstzunehmender »Sehsturz« in diesem Sinne wäre ein Verlust der Fähigkeit zur Kontemplation: außer Stande zu sein sich geistig von dem zu entfernen was man mit den eigenen Augen sieht – und so nicht mehr vom Sehen zur Anschauung gelangen zu können.
Dass man außerhalb der sinnlichen Erfahrung – also nur Kraft seines Verstandes – eine Anschauung entwickeln sollte über das, was Realität ist, dies ist ein Programm welches bis zu den Ursprüngen der modernen Wissenschaften zurückreicht: der Wissenschaftler sollte stets darum bemüht sein sich als beobachtende und beschreibende Instanz von der Welt abzugrenzen und wissenschaftliche Erkenntnisse in Form von neutraler Sprache und Tatsachenbelege zu verfassen – eben nicht mehr in Form unmittelbarer und persönlicher Erfahrung, die ja möglicherweise außerhalb des subjektiven Horizonts und der eigenen Wert- und Vorurteile keine Allgemeingültigkeit mehr hat.
»Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war, außer dem Verstand selbst.« (Leibniz)
Viele Wissenschaftsbereiche entdecken das Sehen in Form der wissenschaftlichen Visualisierung wieder als eine Möglichkeit der kognitiven Modellierung: die Geographie, Meteorologie, Medizin, Astronomie, Physik u.a. sind ohne bildgebende Verfahren heute z.T. nicht mehr in der Lage aktuelle Forschung zu praktizieren. Das künstlich generierte Bild wird sogar als Thinking Tool akzeptiert: das Sichtbare dient nicht allein der Anschauung, sondern dem Denken überhaupt. Der »retinale Raum« erhält somit eine kognitive Funktion. Und es ist ja auch plausibel: ein durchschnittlicher Schachspieler z.B. braucht den Blick auf das Spielbrett um Züge denken zu können.
Es gibt also eine eindeutige Verbindung zwischen dem Sehen und der Anschauung, die sich als eine Abhängigkeit darstellt – und zwar auch in die andere Richtung: es ist auch die Anschauung, die umgekehrt den Blick lenken und zu einer selektiven Wahrnehmung führen kann (»Sehen was man sehen will«). Untersuchungen zur Selektivität von Wahrnehmung (z.B. von Ulrich Neisser und später Daniel Simons zum Thema »Inattentional blindness« oder »Change detection«) zeigen, dass das was wir sehen unmittelbar davon abhängt worauf sich unsere Aufmerksamkeit richtet. Ist diese zu 100% gefordert, bleibt kein Raum mehr um absurde Sachverhalte richtig zu bewerten – schon bei leichter Überforderung ist es erstaunlich leicht, die Korrelation zwischen Sehen und Anschauung zu brechen.
Unheimlich wird es, wenn der Gesichtssinn nicht nur durch Ablenkung überlistet wird, sondern sich nach unserem Verständnis von Wahrheit des Sichtbaren komplett einer bewussten Kontrolle entzieht. Dies lässt sich zum Beispiel bei dem Phänomen der »Motion induced blindness« (bewegungsinduzierte Blindheit) beobachten: das Gehirn gibt sich bewegenden Objekten derartig deutlich den Vorrang, dass statische Objekte zuweilen völlig unsichtbar werden können obwohl wir genau wissen, dass diese vorhanden sind und es keinen physiologischen Grund für ihr Verschwinden geben kann. Für einen Moment jedenfalls erscheint es nachvollziehbar, warum ein Frosch in einem Aquarium voller toter Fliegen verhungert: er nimmt seine Beute nur wahr, wenn sie sich bewegt. Darauf ist sein visuelles System spezialisiert. Und es ist nicht naiv anzunehmen, dass unser visuelles System auf ähnliche Weise spezialisiert ist – wenngleich auch auf Grund anderer Anforderungen.
Die daraus resultierende Frage ist, ob es neben der biogenetischen Spezialisierung auch eine entwicklungspsychologische Spezialisierung gibt und wir gewissermaßen durch die Anforderungen an unser visuelles System nach der Geburt auf diese Art und Weise trainiert werden. Die Lichtreize auf der Retina sind nur der Anfang einer ganzen Reihe von Prozessen, die aus der Wahrnehmungsempfindung irgendwann den Wahrnehmungseindruck machen. Man könnte sogar Vermuten, dass das Wahrnehmen keine Einbahnstrasse ist, sondern wir einen Weltentwurf generieren, der dann durch die Wahrnehmungseindrücke lediglich bestätigt bzw. korrigiert wird. Die Tatsache, dass wir diese aktive Konstruktion einer möglichen Realität nicht als solche erkennen könnte schlicht dem Umstand zu verdanken sein, dass sich die Realität oft berechenbar und erwartungskonform verhält: jeder kann sich auf ein zum Teil Jahrzehnte andauerndes Dauertraining stützen. In dem Maße wie wir in einem Kulturkreis Sehgewohnheiten entwickeln – in diesem Maße wird auch unser visuelles System auf etablierte und konventionalisierte Formen der visuellen Kommunikation eingestimmt. Wir sind gewissermaßen Profis im Generieren von wahrscheinlich zutreffenden Erwartungen. Darum freuen wir uns jedes Mal, wenn etwas Unerwartetes passiert: es zeigt uns, dass die Unterscheidung zwischen Realität (Sehen) und Wirklichkeit (Anschauung) nicht völlig obsolet geworden ist, dass die Weltentwürfe eben nur Modelle sind und wir niemals an den Punkt kommen werden an dem wir nichts mehr dazulernen können.
Die Aufklärung war ein Projekt zur Abschaffung der Mythen als Modelle der Welterklärung: der Mensch sollte sich von verordneter Erkenntnis befreien und nach verstandesmäßigen und rationalen Überzeugungen streben. Die den Bildern innewohne mythische Kraft Stand im Verruf den Verstand zu überlisten und daher hatten die Aufklärer eine tiefe Bildskepsis (Ikonophobie). Erst seit jüngerer Zeit wendet man sich in Form der Bildwissenschaft den Bildern und ihrer Wirkung neu zu (s. »iconic turn« vs. »linguistic turn«). Was fehlt ist die Disziplin einer »Visualistik«, welche die ikonische Wende in Ausbildungsprogramme übersetzt. Die Designausbildung könnte eine solche Vorreiterrolle übernehmen, denn Design befasst sich neben den technischen und semiotischen Aspekten auch mit ästhetischen Fragen der Bilderzeugung.
»Esse est percipi! (Sein heisst wahrgenommen werden!)« (George Berkeley)
Die Ästhetik entwickelt die Theorie des Zusammenhangs zwischen sinnlicher Erfahrung (Sehen) und Sinnhaftigkeit (Anschauung). Die Gestaltung ist im Kern eine Profession, die diesem Zusammenhang nachspürt und ihn zum Teil sogar mitbestimmt: Es geht weniger darum Dinge und Phänomene ästhetisch zu erklären als vielmehr ästhetische Urteile zu fällen und dadurch Dinge zu schaffen. Hierin liegt der kategoriale Unterschied zwischen Wissenschaft und Gestaltung. Gestaltung stand selbst nie wirklich in der wissenschaftlichen Tradition: Nicht die Erkenntnis ist das Ziel, sondern die Gestaltbarkeit (Ästhetisierung des Alltags). Ein Entwurf ist keine theoretische Konstruktion. Dies hat leider bei vielen Gestaltern zu dem Trugschluss geführt, dass sich ein Entwurf in Abwesenheit einer theoretischen Einordnung von selbst legitimieren und argumentieren kann.
Für die Etablierung einer entwurfsbezogenen Visualistik müssen daher noch einige Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, die einer rein analytischen Bildwissenschaft nicht entgegenstehen:
Zuerst ist da eine traditionell anti-diskursive Haltung der Designer und die lähmende Abneigung sich mit theoretischen Implikationen der eigenen Profession zu beschäftigen. Dies scheint so zu bleiben, solange kein Ereignis erkennbar ist, welche die Folgen dieser Aversion in Form eines schleichenden Kompetenzabbaus unzweideutig vor Augen führt.
»Wir sehen nicht, das wir nichts sehen!« (Heinz von Förster)
Zweitens ist die aktuelle Diskussion über die mögliche Auswirkung einer entwurfsbezogenen Visualistik auf das wissenschaftliche Erkenntnisparadigma nicht abgeschlossen. Wir leben längst schon ein einer bildgebundenen Vorstellung von Realität, die in sich selbst schon völlig virtualisiert und simuliert ist. Es scheint nicht klar ob die visuelle Kommunikation zwangsläufig zu dieser Virtualisierung beträgt und ob z.B. die entmystifizierende Wirkung einer Informationsgrafik in Wahrheit genau das Gegenteil bewirkt und den dargestellten Sachverhalt in ein unwirkliches Licht verschiebt, der mit der Realität nicht mehr viel gemein hat.
Drittens könnte man den Eindruck gewinnen, dass die reine Bildflut und ihre Referenzlosigkeit inzwischen zu einer gewissen Bildmüdigkeit und Desensibilisierung für Fragen der Bildkommunikation geführt hat. Einerseits ist man mit einer völlig neuen Form der Bildangst konfrontiert, die den Bildern wegen ihrer emotionalen und manipulativen Wirkung in Politik und Werbung allgemein keine erkenntnisbezogene Absicht mehr zugesteht: die meisten Bilder werden austauschbar, sind immer sich selbst ähnlich und repräsentieren somit auch nichts außer sich selbst. Sie erfüllen dann zuerst den Zweck einer präkognitiven Beeinflussung des Betrachters: die emotionale Vereinnahmung für oder gegen etwas. Andererseits dienen Bilder als Ausgangspunkt psychologisch-kognitiver Projektionen – eben als Träger von Mythen und Referenzen auf persönliche Wunschwirklichkeiten.
»Also, zweifellos unschön ist es, sich in eine „Matrix“-Double-Feature-Night zu begeben und das Neue, penetrant Angepriesene am zweiten Teil zu vorgerückter Stunde schlicht zu verschlafen. [Aber] es war irgendwie doch ganz schön, so weltabgewandt inmitten von dröhnendem Digitalrambazamba.« (Jan Engelmann)
Viertens schafft der Zugang zu visuellen Belegen über die Dinge, die zuvor nur in der Vorstellung verfügbar waren, eine Lust nach der Bildsensation: hierin gleichen sich Pornographie, Augenzeugenvideos, der Splatter-Frag im Computerspiel, die coole Flash-Animation und computergenerierte visuelle Effekte im Kino. Das Bild wird zum Fetisch, einem Instrument der schnellen Befriedigung mit Suchtfaktor.
Dies wirft die Frage auf, ob eine grundsätzliche Untersuchung der Strukturierung des Denkens durch Bilder ein Forschungsbereich ist der im Bezug steht zur Gestaltungspraxis. Die Gegenposition wäre, dass eine solche Untersuchung keine gestaltungsrelevanten Ergebnisse erzeugen könnte und insofern nicht von Gestaltern selbst betrieben werden muss (oder sollte) oder dass hierin eine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen einer berufsqualifizierenden und einer wissenschaftlichen Designausbildung läge (diese Unterscheidung zwischen Berufsqualifizierung und Wissenschaft ist jedoch eine bildungspolitische Konstruktion).
Es liegt auf der Hand, dass sich ohne eine solche Untersuchung innerhalb der Entwurfspraxis genau das bewahrheitet, was im Moment als Hindernisse erscheint: Gestaltung, die gar nicht in der Lage ist irgendetwas anderes zu erzeugen als Fetische, Bildsensationen, Bilderfluten, Simulationen und erkenntnisfreie, willkürliche und austauschbare Resultate. Es wäre eine Gestaltung, die eine neue Bildskepsis schafft – und sich somit selbst ihrer eigenen Legitimation beraubt.
Ich stelle somit einen Appell in den Raum, der eine fehlende »visualistische Kompetenz« in der Visuellen Kommunikation anprangert und zu einer entwurfsbezogenen Neufassung der Visualistik auffordert und diese auch offensiv einer rein analytischen Bildwissenschaft gegenüberstellt. Der »Sehsturz« – aufgefasst als Phänomen gestörter Selbstwahrnehmung (Sehen) und folglich lückenhafter Weltentwürfe (Anschauungen) – ist nach Lage der Dinge also eine Frage, die sich auf jeden Fall auch an die Visuelle Kommunikation selbst richtet.